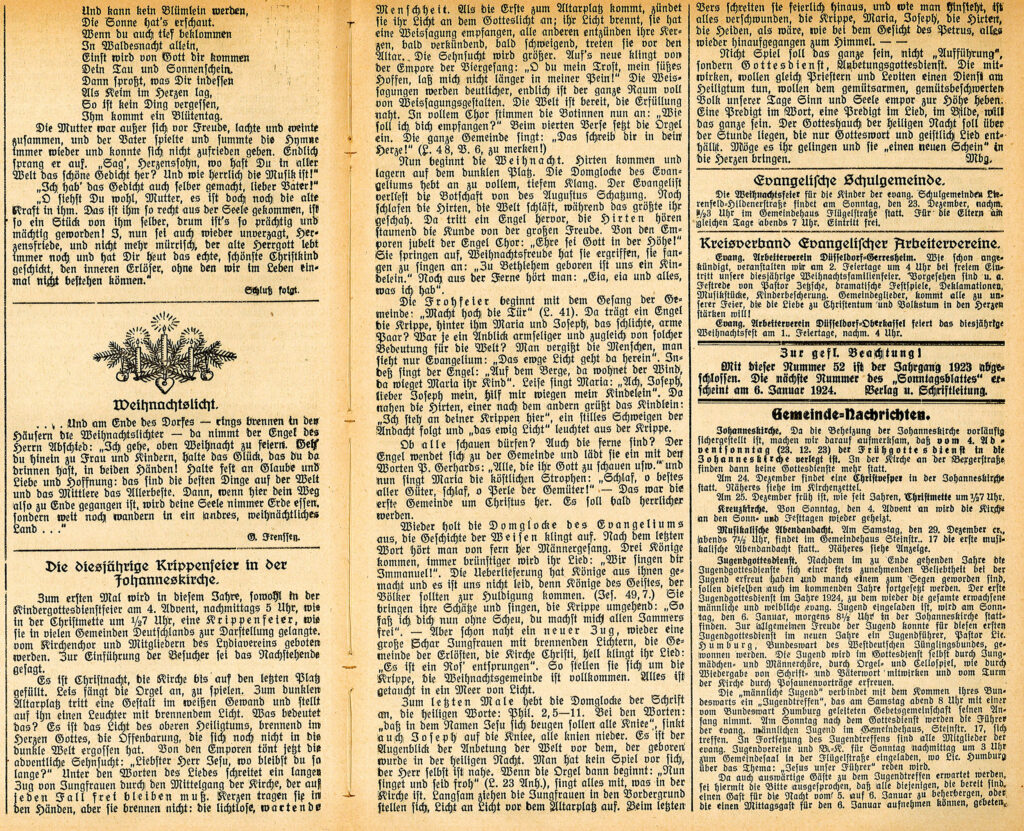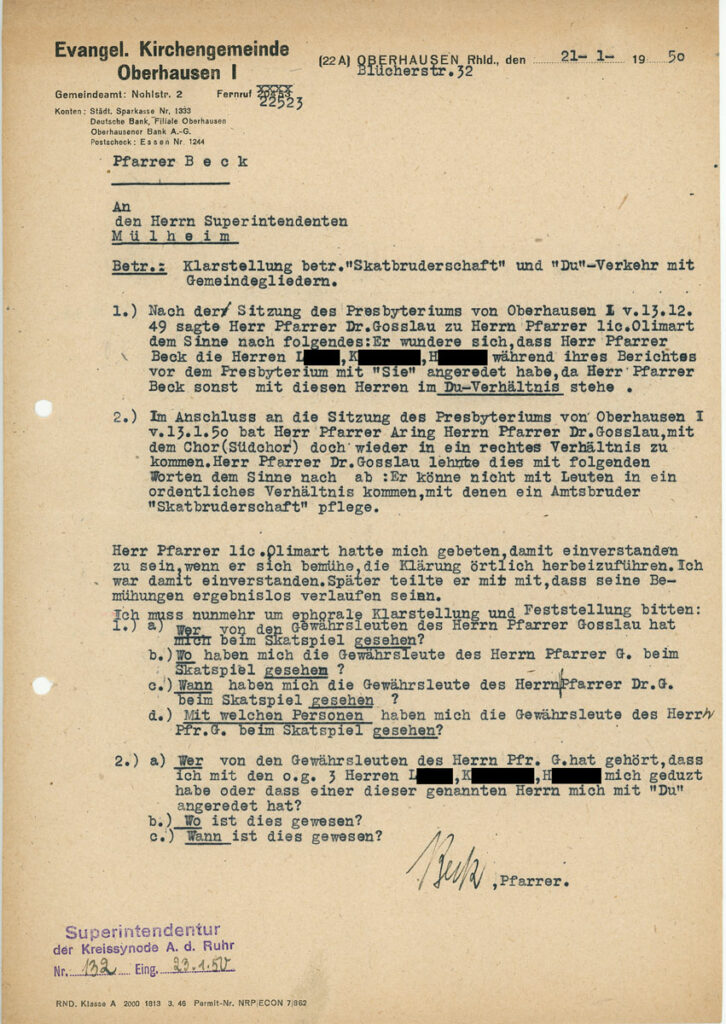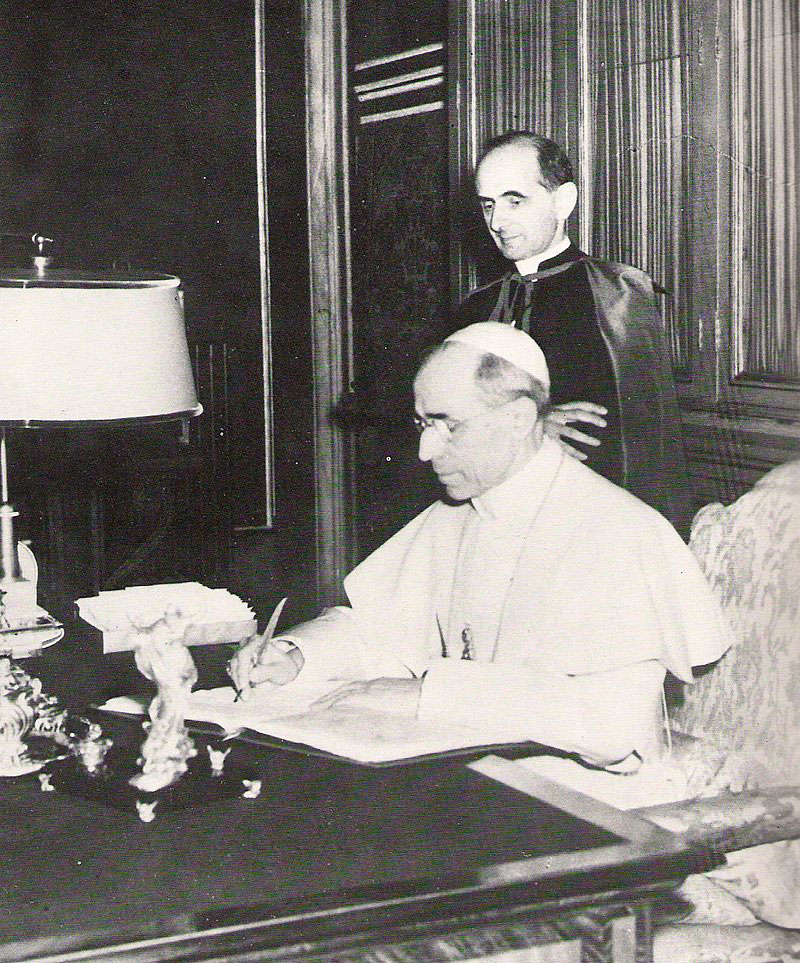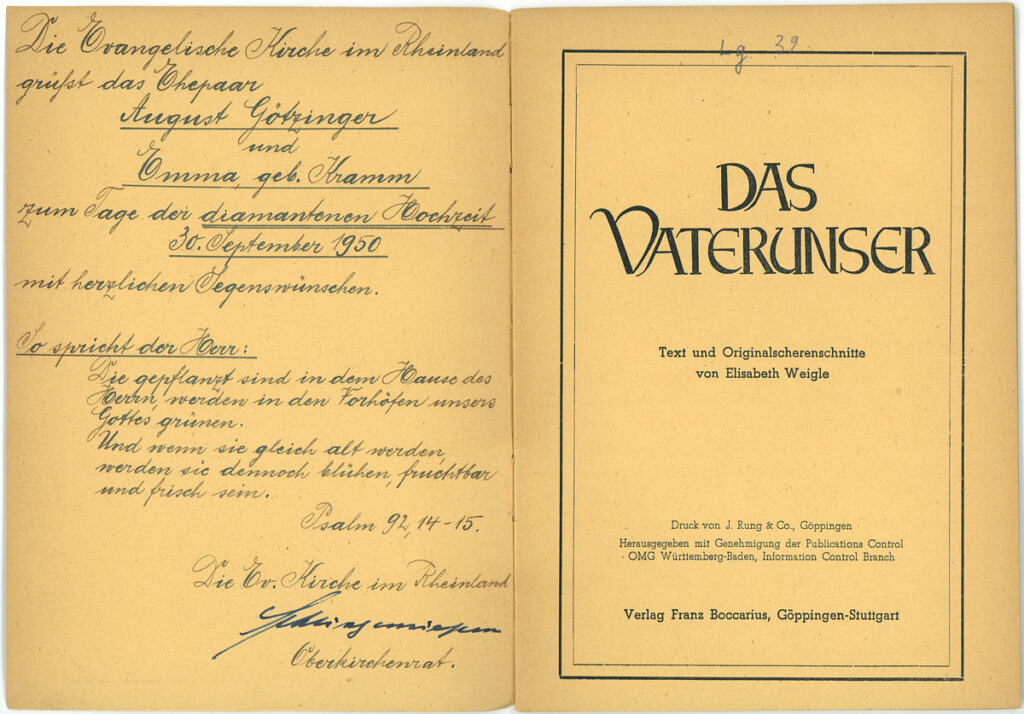Bereits mit Datum vom 29. April 1768 hatte Carl, Fürst zu Nassau, Graf zu Saarbrücken und Saarwerden, Herr zu Lahr, Wißbaden und Idstein etc. verordnet, in welchem beschränkten Rahmen seine Untertanen Hochzeiten, Kindstaufen und Begräbnisse begehen dürfen:
Zur Hochzeit, bei der „durchaus Zucht und Ehrbarkeit beobachtet“ werden solle, dürften „nicht mehr als „höchstens 12 Gäste, ausschließlich der im Hochzeit-Hauß befindlichen Familie“ geladen werden. „Kein Ueberfluß in Essen und Trincken“; „es mag Music und ehrbarer Tanz […] Abends um Zehen Uhr völlig aufgehoben und geendet werden“; „Auch soll von den Gästen […] kein Geschenk […] angenommen werden. Bei Taufen seien weder ein Frühstück vor dem Kirchgang noch eine Mahlzeit in dem „Kindbetter-Haus“ nach der Taufe erlaubt. Leichen dürften nicht in kostbarer Einkleidung, sondern nur im Totenhemd begraben werden, Särge nur aus Tannenholz hergestellt, ohne kostbare Beschläge. „Alle Trost-Weine und Leichen-Schmäuße sind hiermit, bey Zehen Gulden Strafe verbotten.“ Auch das Trauern wurde geregelt, genau genommen geht es um die Frage, wie lange und welche Trauerkleidung getragen werden dürfe.
Weiterlesen