Können Sie spontan etwas mit dem Begriff Spendenfärsen anfangen? Eine Färse (englisch: Heifer) ist bekanntlich ein junges weibliches Rind, das noch nicht gekalbt hat. Weshalb sollte sich das Blog eines kirchlichen Archivs mit diesen Tieren beschäftigen?
Nicht weniger als fünf dicke Aktenhefter im Bestand 5WV 052 (Ev. Hilfswerk) führen den Aktentitel „Spendenfärsen“. Es gab also in den 1950er Jahren offensichtlich intensiven Schriftverkehr um diese gespendeten Kühe. Ausgangspunkt ist die 1944 gegründete und heute noch bestehende amerikanische Organisation Heifer International.
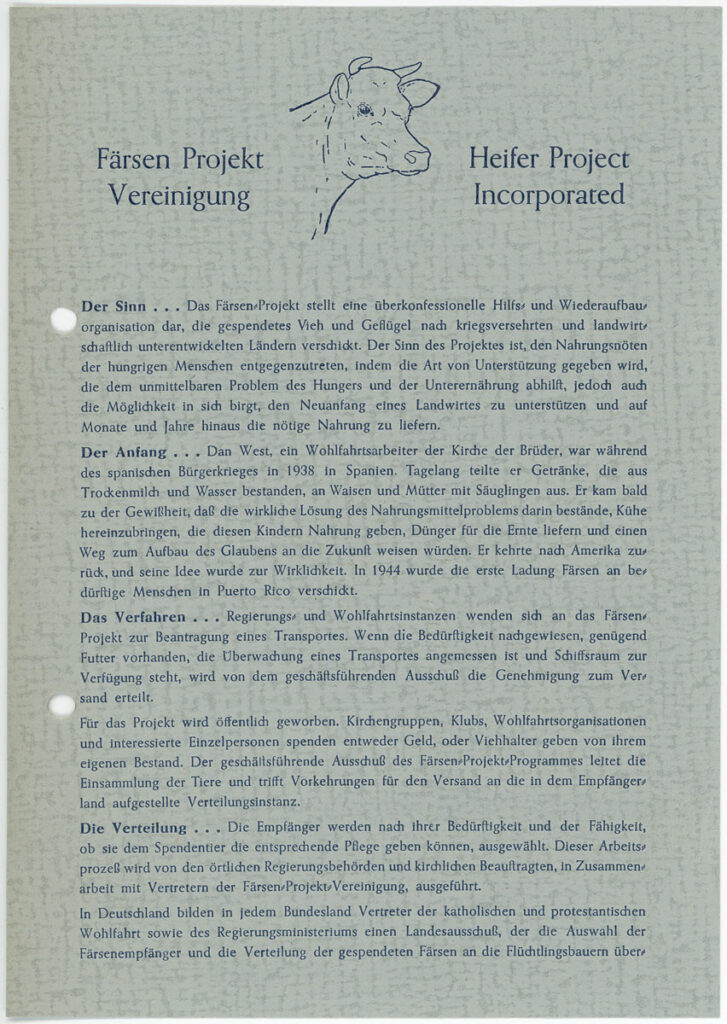
Gemäß deren Auflagen mussten die Empfänger bedürftige Flüchtlinge sein und nachweisen, dass sie bereits in ihrer früheren Heimat als Landwirt tätig gewesen waren. In Deutschland betraf dies in der Regel Vertriebenenfamilien aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie verpflichteten sich, das erstgeborene weibliche Kalb einem anderen bedürftigen Flüchtlingsbauern abzugeben
Das Hilfswerk und auf katholischer Seite die Caritas sorgten im Zusammenspiel mit staatlichen Stellen für die Bearbeitung der zahlreichen Anträge, die oft zunächst von den Ortspfarrern gesammelt und weitergeleitet worden waren. Das Procedere bei einer Übergabe von Tieren in Düsseldorf 1957 veranschaulicht ein Informationsblatt des Hilfswerks:
Weiterlesen
